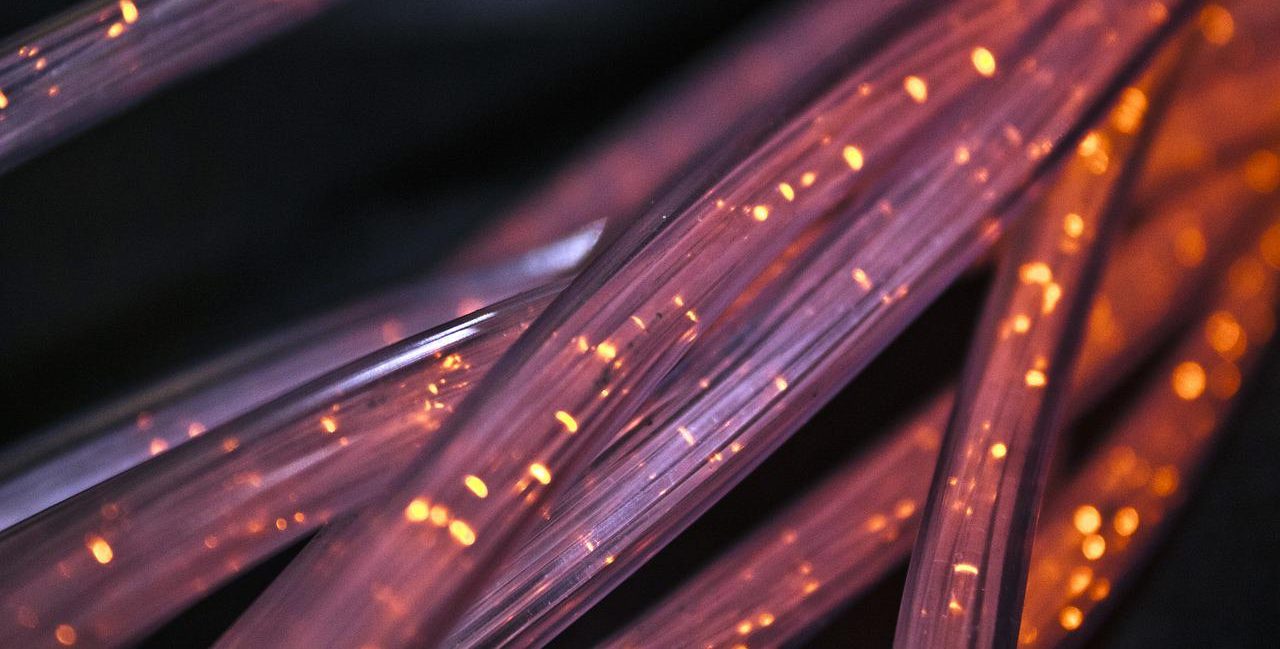Aus dem 5. Teil der was wäre wenn-Reihe:
Was wäre, wenn Social Media den Nutzer*innen gehören würde?
Es ist eine Hassliebe, die die Gesellschaft mit den Plattformen wie Facebook und Youtube pflegt. Auf der einen Seite geben sie vielen Menschen das erste Mal eine Stimme, mit der sie sich in der Öffentlichkeit artikulieren können, oft sogar politisch (es gab zumindest mal eine Zeit, als das als etwas Gutes galt). Auf der anderen Seite handelt es sich um Wirtschaftsunternehmen, die jeden Cent aus unserer Aufmerksamkeit und unseren persönlichen Daten pressen wollen. Zudem ähneln diese Orte weniger öffentlichen Plätzen, als vielmehr privaten Einkaufszentren, in denen man nur wenig bis keine Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten hat.
Es ist deswegen naheliegend, eine Demokratisierung dieser Plattformen zu fordern, wenn wir solche Infrastrukturen schon mit unseren Meinungen und Daten füttern. Was das heißt oder heißen kann, ist ein weites Feld und im Detail eine schwierige Diskussion. Daher orientieren sich hier meine Forderungen nach Demokratisierung an den Modellen und Konzepten, die wir aus den westlichen Industrienationen kennen: Wir wollen gewisse Rechte haben, wir wollen mitbestimmen, wo die Reise hingeht, wir wollen Mindeststandards der Moderation, Transparenz sowie nachvollziehbare Prozesse. Und wir wollen, dass die enorme Macht dieser Plattformen nicht missbraucht wird.
Doch wie genau soll das passieren? Plattformen sind keine Staaten, wir können deren Konzepte nicht eins zu eins übertragen. Zunächst möchte ich vier Möglichkeiten der Demokratisierung von Plattformen vorstellen, ihre Vor- und Nachteile diskutieren und am Ende einen Lösungsvorschlag unterbreiten.
1. Vergesellschaftete Monopole
Ein Problem, das bei Plattformen immer wieder auftaucht, ist ihre Tendenz zum Monopol. Facebook, Amazon und Google sind jeweils auf ihrem Gebiet marktbeherrschend. Bei der Problematisierung wird jedoch oft vergessen zu erwähnen, dass die Monopolisierung auch nützliche Seiten für die Nutzer*innen hat. Stellen wir uns vor, unsere Freunde wären auf zig unterschiedliche Social Networks verteilt, Amazon hätte nur dies und das im Angebot und Google würde nur etwa ein Drittel des Webs kennen. Geben wir es zu: alles (Freunde, Produkte, Suchergebnisse) an einer Stelle zu haben, ist ziemlich praktisch.
Vielleicht sollte man aus diesen Gründen Monopole auch nicht zerschlagen, sondern eher vergesellschaften. Das muss nicht Verstaatlichung bedeuten, es kann auch bedeuten, dass wir alle Anteilseigner*innen einer riesengroßen Genossenschaft werden. Die Idee der „Platform Cooperatives“ wird bereits in vielen US-Städten erprobt. Wir hätten Stimmanteil, wenn es um Grundsatzentscheidungen geht und würden die Gewinne untereinander aufteilen. Zusätzlich könnten wir einige der institutionellen Strukturen, die über die letzten Jahrhunderte Staaten übergestülpt wurden, auch bei Plattformen ausprobieren: Gewaltenteilung, bzw. Checks & Balances, eine Art unabhängige Justiz, die Konflikte auf der Plattform behandelt, Institutionen, die Institutionen kontrollieren, individuelle Rechte, Minderheitenschutz, etc. Am Ende würden wir Entscheidungen über die Weiterentwicklung und Ausgestaltung von Plattformen mit echter, politischer Legitimität ausstatten.
Das hätte natürlich auch Nachteile. Es würde zunächst die Strukturen enorm lähmen und Prozesse verlangsamen, Innovationen bräuchten Ewigkeiten, um bei den Nutzer*innen anzukommen. Alle Entscheidungen würden in Verhandlungen zwischen verschiedenen Interessengruppen verwässert, wie wir es aus der parlamentarischen Demokratie kennen. Amazon sieht aus, wie Jeff Bezos es will. Wie sähe es aus, wenn sich CDU und SPD auf einen Entwurf einigen müssten? Aber selbst, wenn wir davon ausgingen, dass die Leute nicht in Scharen davonliefen, hätten wir immer noch einen unglaublich mächtigen Koloss vor uns, der uns herumschubsen könnte. Wenn wir etwas aus den paar tausend Jahren Demokratiegeschichte gelernt haben, dann, dass auch demokratische Strukturen ins tyrannische kippen können. Was ist, wenn die Konservativen einen Überwachungsalbtraum installierten, oder gar Nazis die Kontrolle übernähmen? Da wäre mir persönlich die politisch vergleichsweise indifferente Zuckerberg-Herrschaft lieber.
2. Verteilte Infrastruktur
Liberale bis libertäre (und meist technologieaffine) Kräfte verfolgen deswegen einen anderen Ansatz: Sie wollen grundsätzlich weg von den großen, zentralen Infrastrukturen und diese stattdessen direkt in die Hände der Leute verteilen. Sie stört nicht nur, dass eine Art diktatorisches Regime in ihr Leben reinregiert, sondern dass überhaupt irgendwer es wagt, ihnen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Keine Macht für niemand!
Ihr Ansatz ist es, die Funktionalität der Plattformen auf ein über die Nutzer*innen verteiltes Protokoll zu übertragen, einen technischen Standard, der es erlaubt, dass unterschiedliche Instanzen einer Software miteinander kommunizieren können.
Am besten sollten die Features und Funktionen komplett im Protokoll implementiert sein. Wer eine Software hat, die mit dem Protokoll sprechen kann (auf dem Handy, durch die Installation einer bestimmten App oder durch die Installation einer Software auf dem Computer), darf mitmachen. Auf diese Art sind alle miteinander vernetzt die das wollen, ohne dass irgendwer fähig wäre Kontrolle über das Netzwerk auszuüben, irgendjemanden auszuschließen oder zu bestrafen. Niemandem „gehört“ das Netzwerk und Entscheidungen können per se nicht gegen die Community getroffen werden.
Auch dieser Ansatz hört sich auf dem Papier erstmal prima an, hat aber mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zunächst wäre da die technische Umsetzbarkeit, denn verteilte Netzwerke müssen auch über eine verteilte Datenhaltung verfügen. All die Nutzer*innen-Accounts und Kommunikationen müssen schließlich irgendwo gespeichert und für die jeweiligen Netzwerkknoten verfügbar gehalten werden. Bei den grundlegenden Protokollen des Internets (TCP/IP) funktioniert das, weil da nicht jeder Rechner jeden anderen Rechner kennen muss, damit das Routing funktioniert, aber bei Facebook wäre das schon blöd wenn ich meine Freunde nicht mehr fände.
Auch eine solche verteilte Infrastruktur hätte das Problem, dass es wahnsinnig zäh wäre, sie weiter zu entwickeln. Wie man bei der Transition des Internetprotokolls von IPv4 auf IPv6 sieht, kann so ein grundlegender Eingriff schon mal 30 Jahre dauern — und er ist bis heute nicht vollzogen. Während Google-CEO Sundai Pichar nur einen Hebel bedienen muss, um die Suchmaschine komplett umzugestalten, müssen bei viel genutzten Protokollen Millionen Menschen Millionen Hebel umstellen, bevor irgendwas passiert. Protokolle sind enorm strukturkonservativ.
Aber selbst wenn man eine technische Lösung für all das finden würde, würden die Probleme erst richtig losgehen. Ein komplett protokollbasiertes Netzwerk wäre kaum moderierbar – was ja gerade von deren Enthusiasten auch als Vorzug gepriesen wird. Totale Meinungsfreiheit! Aber gerade im Internet lassen sich viele Beispiele finden, wie unmoderierte Räume in eine rassistische und sexistische Jauchegrube umkippen. Auch das ist keine wirkliche Demokratie, denn das Fehlen von formellen Ausschlüssen produziert informelle: Minderheiten und Frauen werden systematisch aus solchen Räumen herausgemobbt. Einen unmoderierten, „regierungsfreien“ Raum kann sich nur jemand wünschen, der noch nie von Verfolgung und Diskriminierung betroffen war, weswegen libertäre Tech-Bros, die sowas feiern, in der Regel auch männlich, weiß und heterosexuell sind.
Diese wären auf einer solch pseudo-egalitären Plattform auch noch deswegen bevorteilt, weil technische Finesse für den Erfolg auf der Plattform entscheidend sein dürfte. Am Ende hätten wir also eine sehr hässliche Form der Tech-Bro-Oligarchie statt Demokratie – es wäre nicht viel gewonnen.
3. Dezentrale Instanzen
Es gibt noch eine Art Kompromiss aus den ersten beiden Ansätzen, den ich vorstellen möchte. Auch hier ist das Protokoll entscheidend und bildet viele Funktionen des Netzwerks ab, aber für die Datenhaltung und wesentliche Prozesse braucht es durchaus noch Instanzen mit angeschlossener Datenbank. Das sind Server, bei denen sich Nutzer*innen registrieren können, die Inhalte senden, empfangen, speichern und bereithalten. Beispiele dafür gibt es einige: Zum Beispiel das mittlerweile in die Jahre gekommene Diaspora* und das nach wie vor quirlige Mastodon. Es sind Server, die sich jede*r installieren kann und von denen User*innen über Servergrenzen hinweg in Kontakt treten, darin vergleichbar mit Email, wo Nutzer/innen ja auch zwischen unterschiedlichen Email-Anbietern kommunizieren können.
Auf den ersten Blick vereint dieser Ansatz einige der Vorteile beider Welten – der zentralen und der verteilten. Das Protokoll ist nicht ganz so komplex und die Datenhaltung nicht ganz so aufwändig wie beim verteilten Protokoll-Ansatz, was die technische Umsetzung einfacher macht. Moderation ist auf den jeweiligen Servern durchaus möglich, wenn auch lokal auf die jeweilige Instanz beschränkt. Bei Mastodon kann man zum Beispiel auch Instanzen voneinander entkoppeln, wenn man meint, mit ihr nicht kommunizieren zu wollen. Man kann so auch unterschiedliche Moderations- oder gar Mitbestimmungs-Regime nebeneinander betreiben und Nutzer*innen können sich danach entscheiden, wo sie sich registrieren. Gleichzeitig gibt es keine globale Instanz, die allzu viel Macht akkumulieren und die eigenen Regeln und Interessen allen Instanzen aufoktroyieren könnte.
Aber natürlich gibt es auch hier Probleme. Durch die Verteiltheit der Daten ist es schwierig, seine Kommunikationspartner*innen zu finden, oder auch nur spannende Inhalte über die Suche. Eine globale Suchfunktion, die fähig wäre, alle Server zu durchsuchen, wird zwar angestrebt, ist aber technisch nur schwer umzusetzen und außerdem datenschutztechnisch oft gar nicht erwünscht. Das schränkt Wachstum, Nutzer*innenfreundlichkeit und Netzwerkeffekte ein.
Gleichzeitig kauft man sich einige Probleme des Protokollansatzes ein, beispielsweise die zähe Weiterentwickelbarkeit. Auch hier müssen immerhin hunderte Leute hunderte Hebel in Bewegung setzen, damit eine Neuerung alle Nutzer*innen erreicht.
In der Praxis stellt sich zudem heraus, dass Moderation auch im kleineren Maßstab ein Job ist, der zumindest die Teilzeitbetreiber*innen der Instanzen oft überfordert. Aber mit welchen Mitteln sollen sie Leute anstellen? Geld verdienen ist schwierig bis unmöglich mit einem Service, den im Zweifel jede*r anbieten kann. Und da viel Kommunikation zwischen den Instanzen stattfindet, kommt es auch immer wieder zu konfligierenden Moderationsstandards.
In der Praxis sind diese Ansätze wegen der vielen Probleme zwar durchaus gangbar, aber immer nur begrenzt erfolgreich. Sie ziehen oft nur Idealist*innen an, die dann im virtuellen Sitzkreis davon erzählen, wie schlimm die kommerziellen Plattformen doch sind und versichern sich der Überlegenheit ihres technischen Ansatzes.
4. Marktbasierte Monopole
Als letztes möchte ich den Istzustand skizzieren, weil er zwar offensichtlich scheint, aber aus unserer jetzt gewonnen Perspektive verdient, ebenfalls mit seinen Vor- und Nachteilen eingeordnet zu werden.
Marktbasierte Monopole wie Facebook oder Amazon haben den offensichtlichen Vorteil, dass sie ihre technische, wirtschaftliche und soziale Machbarkeit bereits unter Beweis gestellt haben. Einer der Gründe dafür wird sein, dass sie mit vielen Schwierigkeiten der demokratischeren Herangehensweisen nicht zu kämpfen haben: Ihre Entwicklungszyklen sind kurz, das Ausrollen von Features ist schnell und unproblematisch und erfolgt regelmäßig. Durch die zentrale Datenspeicherung erlauben sie eine gute Durchsuchbarkeit, was die potentiellen Netzwerkeffekte der Plattformen voll ausschöpft. Diese Firmen sind mit hinreichendem Kapital ausgestattet, was ihnen nicht nur erlaubt, ihre Plattformen schnell weiter zu entwickeln, sondern auch die enorm ressourcenaufwendige Moderation zu bewerkstelligen (auch wenn sie da noch viel Luft nach oben haben).
Marktverfechter würden an dieser Stelle noch anfügen, dass Demokratie doch schon deswegen umgesetzt sei, weil man eine Plattform jederzeit wechseln kann. Demokratie mit den Füßen sozusagen.
Dass dieses Narrativ angesichts der sprichwörtlichen Monopol-Tendenzen der Plattformen wenig glaubhaft ist, wäre nur das erste Problem. Als Konsument*innen haben wir nur eine Pseudowahl zwischen den Anbietern – wir gehen mit gutem Grund dahin, wo die Produkte sind, die wir kaufen wollen, oder die Freunde sind, mit denen wir kommunizieren wollen. Das Problem nennt man Lock-In-Effekt und wird von gewinnorientierten Plattformen natürlich forciert. Am Ende ist man doch einem Regime quasi ausgeliefert, womit wir wieder am Anfang wären.
Es gibt aber noch einen wenig beachteten Nachteil kommerzieller Plattformen: Um ein Geschäftsmodell zu haben, müssen sie den Zugang zu bestimmten Dingen auf der Plattform künstlich einschränken. Seien es unsere Daten, unsere Aufmerksamkeit, der Zugang zu bestimmten Kommunikationstools oder gar unseren Freunden, etc. – Irgendwo braucht es eine Schranke, damit irgendwer Geld bezahlen muss, um sie zu überwinden. Das heißt im Endeffekt, dass alle kommerzielle Plattformen gezwungen sind, ihre Dienste künstlich schlechter zu machen, als sie sein müssten.
Die Lösung heißt Stapel
An dieser Stelle lässt sich bereits das Fazit ziehen, dass es zwar viele Ansätze zur Demokratisierung von Plattformen gibt, sie aber alle ihre Probleme und Fallstricke haben, von denen sich nicht wenige als fatal erweisen werden. Ich möchte deswegen keinen der vorgestellten Ansätze empfehlen — sondern einen Mix daraus. Genauer: einen Stapel.
Protokolle kommen gerne in Form von Stapeln daher. Das ist eine metaphorische Betrachtung davon, wie Protokolle miteinander zusammenarbeiten. Ein berühmtes Beispiel ist das Internet selbst, der Protokollstapel TCP/IP, bei dem Protokolle auf der Vorarbeit von anderen Protokollen aufsetzen, auf deren Grundlage dann weitere Protokolle arbeiten, etc. Die Ebenen arbeiten jeweils voneinander unabhängig, so dass sich auf diese Weise eine aufeinander aufbauende Komplexität managen lässt, die eine vergleichsweise große Flexibilität und Heterogenität der Ansätze erlaubt. Das heißt, man kann zum Beispiel einzelne Protokolle auf ihrer jeweiligen Ebene durch andere ersetzen, ohne dass der Gesamtstapel aufhört zu funktionieren.
Wenn wir die Stapelmetapher zur Grundlage unserer Demokratieüberlegung machen, stellen wir fest, dass wir uns gar nicht für nur eines der vorgestellten Modelle entscheiden müssen. Wir können auch versuchen, einen Stapel zu designen, der in seinen jeweiligen Schichten die einzelnen Ansätze miteinander verbindet und so „the best of all worlds“ miteinander verknüpft.
Das Modell: gestapelte Demokratie
Ein wiederkehrendes Problem bei den unterschiedlichen Demokratisierungsansätzen ist der Widerspruch zwischen Demokratisierung und Agilität. Je „demokratischer“ ein Ansatz ist, desto zäher ist seine Weiterentwicklung. Das gilt für die vergesellschafteten Monopole, noch mehr für die verteilten Protokolle und gemindert auch für die dezentralen Instanzen.
Nun haben Protokollstapel die Eigenschaft, dass die unterste Ebene die konservativste ist. Diese Ebene zu ändern ist aufwändiger als die darüber liegenden Ebenen, da alle nachkommenden immer von der untersten Ebene abhängig bleiben. Das heißt: Je tiefer man in den Protokollstapel eingreift, desto behutsamer und geduldiger muss man sein.
Daraus ergibt sich logischerweise folgendes Design: Unser Modell sollte je nach Flexibilitäts- und Demokratieanforderungen von oben nach unten ansteigend konservativ und gleichzeitig demokratischer definiert sein. Oben kommen die weniger demokratischen, dafür umso agileren Ebenen zum Tragen, doch je tiefer wir gehen, desto mehr Demokratisierungskonzepte werden implementiert und im Layer festgeschrieben.
Ich werde hier nun in einem waghalsigen Manöver ein Demokratisierungskonzept für Plattformen entwerfen, von dem ich glaube, dass es so oder so ähnlich funktionieren könnte. Dafür denke ich mir der Einfachheit halber das Modell eines Social Networks aus, das demokratisch, aber doch funktional organisiert sein kann. Es hat vier Schichten und ich nenne es im Folgenden nur „Das Modell“.
Oberste Schicht: Client-Markt
Im Stapelmodell des Internets ist die oberste Schicht der so genannte „Application-Layer“, also im Grunde das, womit die Nutzer*innen tagtäglich operieren: Websites, Mail-Clients, Apps. Auch in unserem Modell wollen wir hier einsteigen, nämlich bei den „Clients“. Clients sind Software, die man sich auf dem Telefon oder Computer installieren kann und über die man mit Services kommuniziert. Etwa ein Twitter-Client oder ein Email-Client — in unserem Fall also ein „Modell-Client“.
In unserem Modell bilden die Clients einen ganz normalen Markt, in den jede*r einsteigen kann. Manche kosten Geld oder haben ein anderes Geschäftsmodell, andere sind Open Source. So lange sie fähig sind, mit den darunterliegenden Ebenen zu kommunizieren, dürfen sie mitspielen. Das hat den Vorteil, dass sich auf dieser Ebene enorm schnell Neuerungen ergeben und durchsetzen können. Klar, der Markt wird hier sicher über Zeit seine Lieblinge herausmendeln, aber mit etwas Marktkonzentration können wir auf dieser Ebene gut leben, so lange die darunter liegende Ebene der föderierten Instanzen durch ihre Heterogenität bei gleichzeitiger Interoperabilität einen Lock-In unterbinden. Was das bedeutet wird im nächsten Absatz gezeigt.
Zweite Schicht: föderierte Instanzen
Hubs sind Server-Instanzen, die gemäß des dezentralen Ansatzes ihre jeweiligen User-Basen verwalten. Dass sie „interoperabel“ sind, bedeutet, dass man auf sie mit jedem beliebigen Client zugreifen werden kann und dass die Instanzen selbst untereinander Kommunikation ermöglichen. Für User*innen bedeutet das, dass sie weder an einen bestimmten Client, noch an eine bestimmte Instanz gebunden sind.
Einzelne Instanzen können sich sowohl von den Features, als auch von der demokratischen Struktur ihres Regimes unterscheiden. User*innen können sich so aussuchen, welche Moderations- und Mitbestimmungsregime für sie am besten passen. Den Instanzen liegt ein gemeinsames Basiscode zugrunde, der sie wie ein gemeinsamer Nenner verbindet.
Auch in der politischen Ausgestaltung ihres Regimes haben die Instanzen weitgehende Freiheiten, solange sie gewisse Mindeststandards erfüllen, die von der darunter liegenden Ebene — dem zentralen Meta-Governance — definiert werden.
Dritte Schicht: Zentrales Meta-Governance
Das „Metagovernance“ ist die verallgemeinerte, politische Ebene des Modells und besteht aus vier Organen:
- Der Entwickler-Rat besteht aus Vertreter*innen der Entwickler*innen der Codebasis, sowie der unterschiedlichen Distributionen und den Betreiber*innen der Instanzen. Er beschließt alle paar Wochen wichtige Weichenstellungen für die Codebasis.
- Dieser wird dabei vom User-Rat kontrolliert, einem Organ an dem User*innen jeweils proportional zur Größe der Instanzen angehören. Die Mitglieder des User-Rats werden einmal im Jahr per Los bestimmt und können mit einfacher Mehrheit ein Veto gegen jede Entscheidung des Entwickler-Rats einlegen.
- User-Rat und Entwickler-Rat bilden gemeinsam den Modell-Rat und beschließen Änderungen am sogenannten Meta-Governance-Framework. Das ist ein Dokument, das Mindeststandards für die Regimes der Instanzen festlegt. Eine Art Grundgesetz, in dem Mitbestimmungsmöglichkeiten, Gewaltenteilung, Eckpunkte eines Justizsystems und Minderheitenschutz festgeschrieben sind. Eine weitere Regel ist, dass alle Instanzen des Modells miteinander kommunizieren können müssen. Eine Änderung des Frameworks erfordert eine Zweidrittelmehrheit des Modell-Rats.
- Das Schiedsgericht ist das dritte Organ der Meta-Governance. Es besteht aus juristisch gebildeten Vertreter*innen von User-Rat und/oder Entwickler-Rat, die von und aus beiden Organen für jeweils fünf Jahre gewählt werden. Das Schiedsgericht entscheidet Metakonflikte sowohl auf User- als auch auf Instanz-Basis. Zudem verwaltet es die sogenannte „Metadatenbank“.
Die Metadatenbank ist in erster Linie eine Liste der Instanzen, die sich den Mindeststandards der Meta-Governance unterordnen. Eine Aufgabe der Metadatenbank ist es, die Streams mit Daten der Instanzen und Nutzer*innen aufzunehmen und damit öffentlich auffindbar zu machen, sofern sie das wollen. Clients (erste Schicht) unterscheiden sich vor allem auch darin, wie gut sie die Daten der Metadatenbank auswerten, um sie ihren Nutzer*innen zum Beispiel als personalisierten News-Stream oder als Inhalte-Suche verfügbar zu machen.
Unterste Schicht: Protokoll
Die unterste Ebene sollte das eigentliche Protokoll sein, denn es ist schwer zu verändern und gleichzeitig schwer zu kontrollieren. Es gehört allen, wie die Sprache und wie die Sprache verändert es sich nur in Zeitlupe. Das Protokoll ist ein Kommunikationsstandard, der einerseits generisch genug ist, alle denkbaren Kommunikationsfälle abzubilden, aber auch konkret genug ist, dass es die Last vieler Entscheidungen von den Schultern der Inistanzen und ihren Entwickler*innen nimmt.
Das Protokoll kann nur durch eine Zweidrittelmehrheit des Entwickler-Rates geändert werden, der User-Rat kann das mit einfacher Mehrheit aber verhindern. Ein Feature kann nur dann in das Protokoll aufgenommen werden, wenn es bereits erfolgreich in mindestens zwei Instanzen implementiert wurde und dort auch zwischen diesen getestet worden ist.
TBD — To be discussed
Obwohl hier der Platz dafür fehlt, muss mitgedacht werden, dass die Finanzierungsstruktur essentiell ist. Alle Demokratisierungsstruktur ist hinfällig, sobald das Modell finanziell vom Wohl und Wehe weniger Akteure abhängt.
Das ist natürlich nur eine freihändige Skizze mit vielen Lücken und mit Sicherheit vielen kleinen Teufelchen im unausgeführten Detail. Sie adressiert aber zumindest die offensichtlichsten Probleme der vier oben genannten Demokratisierungsansätze. Auch wenn man nicht allen Ideen, Konzepten und von mir entworfenen Institutionen zustimmt und alles ganz anders bauen würde, hoffe ich, zumindest gezeigt zu haben, dass ein stapelartiger Aufbau für Plattformen ein nützliches Konzept ist. Meine Hoffnung ist, dass dies als eine Blaupause oder Anregung für weitere Diskussionen und Modelle dienen kann.
Autor*in

Michael Seemann arbeitet als Blogger und freier Autor für verschiedene Medien in Berlin. Der Kulturwissenschaftler beschäftigt sich vor allem mit den Themen Whistleblowing, Datenschutz, Urheberrecht, Internetkultur und Plattformen. Zum digitalen Kontrollverlust hat er ein Buch geschrieben. [Foto: Steffi Roßdeutscher]
Was wäre, wenn…
… Social Media den Nutzer*innen gehören würde?
Im 5. Teil unserer was wäre wenn-Reihe sprechen wir über Social Media Nutzer*innen. was wäre wenn ist das Online-Magazin der Initiative Offene Gesellschaft für konkrete Utopien. Unser Ziel ist es, Alternativen für die Gesellschaft sichtbar zu machen und potenzielle Lösungen ins Zentrum zu rücken.
Jedes Thema wird mit einer was wäre wenn-Frage eröffnet und anschließend in Essays, Interviews und in einem begleitenden Podcast diskutiert. Zum Wesenskern unseres Magazins gehört die Pluralität der Stimmen und Perspektiven. Die Inhalte werden deshalb, neben journalistischen Beiträgen, vor allem von Expert*innen aus Wissenschaften, Praxis und Zivilgesellschaft verfasst.
Weitere Artikel zum was wäre wenn-Thema “Social Media Nutzer*innen”:
- Was wäre, wenn Social Media den Nutzer*innen gehören würde? – von Georg Dietz
- Der Staat neben den Staaten – von tante
- Kryptokommunist*innen aller Länder, vereinigt euch! – von Erik Bordeleau
- „Eine Dynamik, die man Klassenbildung nennen könnte“ – Interview: Lukas Hersmeier
- „Wir im Westen können uns leisten, das Netz kritisch zu sehen“ – Interview: Valie Djordjević
- Dezentralisiert euch! – von Dennis Schubert