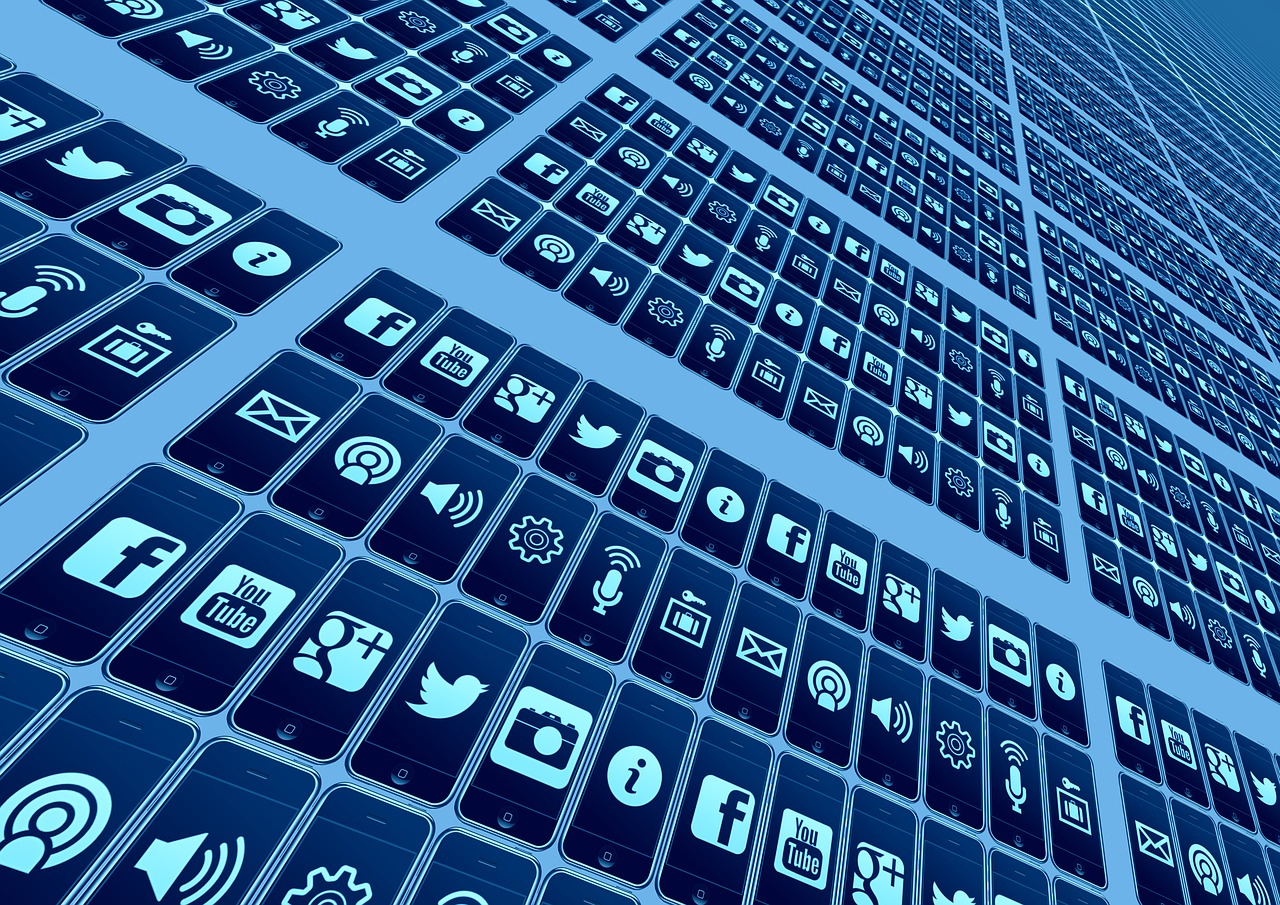Aus dem 5. Teil der was wäre wenn-Reihe:
Was wäre, wenn Social Media den Nutzer*innen gehören würde?
In der neuen Ausgabe stellen wir die Frage: Was wäre, wenn Social Media den Nutzer*innen gehören würde? Würdet ihr sagen, dass diese Formulierung bereits irreführend ist, weil der Tech-Diskurs eben zu oft nur um die Nutzer*innen kreist und zu selten über die Menschen gesprochen wird, die für Unternehmen wie Facebook arbeiten?
Ben Tarnoff: Ja, ich denke, dass bei jeder Bemühung, gemeinschaftliche Alternativen zu den großen, kommerziellen Plattformen aufzubauen, ernsthaft an die Arbeitskräfte gedacht werden muss, die diese Plattformen erst möglich machen. Die Softwareentwickler*innen, Content-Moderator*innen, Produktdesigner*innen, Data-Center-Techniker*innen und so weiter. Es gibt zwar auch einen theoretischen Diskurs, oft mit dem Post-Operaismus assoziiert, der besagt, dass diese Plattformen auf der „freien Arbeit“ ihrer Benutzer*innen beruhen – dass die Benutzer*innen sozusagen die Arbeiter*innen sind. Aber mal abgesehen von der umstrittenen Frage, ob ein Facebook-Post oder eine Google-Suchanfrage wirklich als „Arbeit“ betrachtet werden kann – ich habe meine Zweifel –, muss eben eine ganze Menge traditioneller Lohnarbeit geleistet werden, damit diese Plattformen funktionieren. Und wenn diese Arbeit nicht geleistet wird, merkst du es als User*in sofort, die Website ist down, die User Experience ist mies oder ein extremes Gewaltfoto erscheint in deinem Feed. Facebook hat rund 37.700 Vollzeitbeschäftigte und eine unbestimmte Anzahl von Leiharbeiter*innen – aber 2,38 Milliarden aktive Nutzer*innen pro Monat. Insofern ist es natürlich verständlich, dass wir normalerweise den Fokus auf die Nutzer*innen legen. Aber die Arbeiter*inneren existieren.
In den letzten Jahren haben die Beschäftigten aller großen Tech-Unternehmen – Google, Facebook, Amazon etc. – in irgendeiner Form gegen ihre eigenen Arbeitgeber protestiert. Die Arbeitsbedingungen in diesen Unternehmen sind seit langem problematisch, in den meisten Fällen wohl von Beginn an. Wie erklärt ihr euch die aktuelle Protestbewegung der Tech-Arbeiter*innen?
Tarnoff: Die kurze Antwort lautet: Trump. Aber natürlich ist es etwas komplizierter. Im September 2017 schrieb der Journalist Josh Eidelson für Bloomberg einen Artikel darüber, wie sich Tausende Servicekräfte im Silicon Valley – Busfahrer*innen, Sicherheitsbedienstete, Gastronomiemitarbeiter*innen – in den vergangenen Jahren gewerkschaftlich organisiert hatten. Diese Welle war wichtig für das, was heute als tech worker movement bezeichnet wird. Und zwar, weil diese Servicekräfte genauso als tech workers betrachtet werden sollten – und, weil das kollektive Handeln der blue-collar workers das kollektive Handeln der white-collar workers inspiriert hat.
Trump und die Tech-CEOs
Aber Trump hat sicherlich einen wichtigen Wendepunkt markiert. Für viele der Tech-Arbeiter*innen war es eine ernüchternde Erfahrung, die Vorstände ihrer Unternehmen dabei zu beobachten, wie sie sich nach der Wahl Trump angenähert haben. Auch, weil sich mehrere Silicon-Valley-Führungskräfte noch während des Wahlkampfes gegen Trump ausgesprochen hatten. Das Foto, das im Dezember 2016 im Trump Tower während des sogenannten „Tech-Gipfels“ aufgenommen wurde und Trump neben Leuten wie Sheryl Sandberg, Jeff Bezos und Larry Page zeigte, hat dabei besonders viele politisiert. Ich möchte der Wahl Trumps allerdings nicht zu viel Bedeutung zusprechen, weil sich die Bewegung auch aus anderen Strömungen zusammengesetzt hat. Vor allem Frauen und People of Color haben lange davor erkannt, dass ihre Interessen mit denen der Managements nicht zwangsläufig übereinstimmen. Diese marginalisierten Gruppen haben schon immer über eine komplexere Machtanalyse verfügt, was mit der Erfahrung verschiedener Formen der Unterdrückung zu tun hat, in einer Industrie, die bis heute eben sehr weiß und sehr männlich ist.
Moira, du schriebst 2017 in einem Artikel, dass „die meisten Medien und das politische Establishment über Jahrzehnte hinweg das Versprechen geschluckt haben, dass das Silicon Valley nicht ‚böse ist’“. Kann man die Tech-Worker-Bewegung auch als Reaktion auf dieses gebrochene Versprechen betrachten?
Moira Weigel: Ich glaube, das kann man. Viele white-collar workers, die an dieser Bewegung beteiligt sind, haben mir gegenüber ein Gefühl der Desillusionierung beschrieben. Über die Kluft zwischen der Rhetorik, die diese Industrie verwendet und den Realitäten, die die Industrie kreiert. Für manche war das ein gradueller Prozess, für andere geschah es mit einem Male. Und ich spreche hier ganz bewusst von white-collar workers, weil die blue-collar workers im Großen und Ganzen weniger von der Weltverbesserungsrhetorik des Silicon Valleys eingenommen sind. Was nicht heißen soll, dass kein blue-collar workers jemals begeistert ist, bei großen Tech-Unternehmen zu arbeiten. Aber vermutlich haben sie immer etwas klarer das Wesen dieser Unternehmen als das betrachtet, was es ist: viel mehr profitorientiert als altruistisch. Und sie haben auch erkannt, auf welche Art und Weise die astronomisch wachsenden Unternehmen den Communities um sie herum schaden können.
Informations-Utopismus der Anfangsjahre
Wie Ben schon sagte, war die Wahl von Trump ein wichtiger Wendepunkt. Historisch betrachtet ist das Silicon Valley politisch liberal-libertär orientiert, die meisten Tech-CEOs wählen die Demokratische Partei, haben Hillary Clinton unterstützt und sich während des Wahlkampfes über Trumps offenen Rassismus, Sexismus und Fremdenfeindlichkeit entsetzt gezeigt. Als viele dieser Tech-CEOs dann nach der Wahl im Trump Tower zusammenkamen, waren viele ihrer Angestellten geschockt. Es sei ein Moment gewesen, sagen viele, in dem sie realisiert hätten, für welche Zwecke ihre Technologien auch genutzt werden könnten. Die Konsequenzen von Datenspeicherung und Cloud-Computing beispielsweise. Wobei andere Tech-Arbeiter*innen schon viel länger besorgt sind, seit den Snowden-Enthüllungen oder früher, und sich auch über die Verbindungen zwischen Silicon Valley und dem Militär oder den rassistischen Praktiken der Polizei bewusst sind.
Es ist interessant: Der Legende nach stammt der Spruch „Don’t be evil“ ursprünglich von einem Techniker, der darüber sprach, warum es für Google wichtig gewesen sei, die Werbeanzeigen von den Suchergebnissen zu trennen. Nicht „böse zu sein“ bedeutete, das Interesse der Nutzer*innen zu schützen, in dem ihnen die bestmöglichen Informationen zu Verfügung gestellt wurden. Mit anderen Worten – die Nutzer*innen nicht an den Anzeigekunden zu verkaufen, der am meisten zahlt. Dieser Glaube spiegelte eine Art von Informations-Utopismus wider, der bis zu den Anfängen des Silicon Valleys zurückreicht. Und zwar zu der Idee, dass die Verantwortung eines Unternehmens schlicht darin bestehe, den Menschen Fakten zu vermitteln oder gute Werkzeuge herzustellen — und der Rest würde sich schon ergeben. Ich glaube, dass sich die Tech-Worker-Bewegung mittlerweile komplexer mit Gut und Böse, beziehungsweise mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, auseinandersetzt, und eben auch damit, wie die Tech-Industrie ihre Arbeiter*innen behandelt und inwiefern es Gemeinsamkeiten mit Arbeiter*innen anderer Industrien gibt. In diesem Sinne haben sie nicht nur den Glauben an „Don’t be evil“ verloren, sondern neudefiniert, was es bedeutet, nicht „evil“ zu sein.
Was sind denn bislang die bemerkenswertesten Erfolge der Tech-Worker-Bewegung?
Tarnoff: Neben den bereits erwähnten Gewerkschaftskampagnen der Silicon-Valley-Servicekräfte würde ich zwei Erfolge nennen: Im Juni 2018 gaben die Chefs von Google bekannt, dass sie den Vertrag mit dem Pentagon für das „Projekt Maven“ nicht verlängern werden – ein Projekt, das Machine Learning zur Drohnenüberwachung und Zielerfassung genutzt hat. Diese Entscheidung war das direkte Ergebnis einer Kampagne von Google-Mitarbeiter*innen.
Die gemeinsame Identität der Arbeiter*innen
Ein weiterer bedeutender Sieg war der „Google Walkout“, ein global organisierter Protest gegen sexuelle Belästigung und Diskriminierung, an dem 20.000 Google-Mitarbeiter, sowohl Vollzeit- als auch Vertragsarbeiter*innen, in 50 Standorten auf der ganzen Welt beteiligt waren. Das Google-Management stimmte in der Folge einer Kernforderung der Walkout-Organisator*innen zu, nämlich der Abschaffung des verpflichtenden Schlichtungsverfahren zwischen mutmaßlichen Täter*innen und Betroffenen bei sexuellen Übergriffen. Andere Tech-Unternehmen wie Facebook und Microsoft haben daraufhin ähnliche Maßnahmen getroffen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die meisten Forderungen der Walkout-Organisator*innen letztlich unerfüllt geblieben sind. Ein weiterer Punkt, den ich erwähnen möchte, sind die Leiharbeiter*innen, die in der Regel schlechter verdienen und weniger Rechte als ihre festangestellten Kolleg*innen haben. Leiharbeiter*innen haben sich an verschiedenen Aktionen und Protesten beteiligt, oft in Zusammenarbeit mit Vollzeit-Arbeitskräften.
Das Magazin Wired schrieb im vergangenen Dezember, dass 2018 das Jahr gewesen sei, „in dem die Tech-Arbeiter*innen erkannten, dass sie Arbeiter*innen sind”. Würdet ihr dem zustimmen? Oder ist es vielmehr so, dass die Medien das jetzt erst erkannt haben?
Tarnoff: Ich würde schon sagen, dass das wahr ist. Die Autorin dieses Artikels, Nitasha Tiku, ist eine meiner Lieblingsreporter*innen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und sie sprach mit den richtigen Leuten für dieses Stück, unter anderem mit Stephanie Parker, eine der Organisator*innen des “Google Walkouts”, die dieses wunderbare Zitat lieferte:
“Zu beobachten, wie Cafeteria-Mitarbeiter*innen und Sicherheitskräfte der Silicon-Valley-Unternehmen auf tapfere Weise mehr Leistungen und Respekt forderten, war für mich und viele andere Tech Workers eine zutiefst inspirierende Erfahrung in diesem Jahr. Es hat mir geholfen, Parallelen zwischen den Anstrengungen der Servicekräfte und meiner eigenen Erfahrung als Schwarze Frau in der Tech-Industrie zu erkennen, und es hat mir auch dabei geholfen, mich mit den Bemühungen anderer Industrien solidarisch zu zeigen, wie zum Beispiel mit dem Streik der Marriott-Hotel-Mitarbeiter*innen.”
Stephanie beschreibt hier eine Dynamik, die man Klassenbildung nennen könnte. Wie und wann beginnen die Arbeiter*innen, sich selbst als Arbeiter*innen zu betrachten? Diese Wahrnehmung nämlich eröffnet völlig neue Wege des gemeinsamen Denkens und Handelns. Es hilft den Menschen, sich weniger allein zu fühlen. Am Ende des Tages sind die meisten Menschen zwangsläufig Arbeiter*innen, sprich: sie arbeiten, um zu überleben — und erleben dabei auf unterschiedliche Art und Weise Ausbeutung und Herrschaft. Wer sich als Arbeiter*in identifiziert, kann sich eine gemeinsame Identität erschließen und dadurch etwas Starkes bauen.
Wie würdet ihr den Begriff „Tech Worker“ definieren? Sind das alle, die in der Tech-Industrie arbeiten oder nur die blue-collar workers? Und ergibt diese strikte Trennung zwischen blue-collar workers und white-collar workers hier überhaupt Sinn?
Tarnoff: Das ist eine schwierige und faszinierende Frage. Ich würde sagen, dass es darauf eine strategische und eine theoretische Antwort gibt. Die gängige Definition innerhalb der Tech-Worker-Bewegung lautet, dass alle „Tech Worker“ sind, die in irgendeiner Weise für ein Tech-Unternehmen arbeiten. Bedeutet, Google-Shuttle-Busfahrerinnen, Amazon-Lagerhallenarbeiter, Facebook-Content-Managerinnen, Uber-Fahrer und Microsoft-Softwareentwicklerinnen. Diese breite Definition hilft dabei, Solidarität, Austausch und Koordination zwischen den Arbeiter*innen herzustellen. Ein gutes Beispiel dafür war der Brief eines Uber-Technikers an einen Uber-Fahrer.
Diese umfassende Definition des Begriffes hört allerdings irgendwann auf, für die Analyse nützlich zu sein. Die gerade genannten Arbeitsfelder sind nämlich ziemlich unterschiedlich, wenn es um Gehälter, Arbeitsbedingungen, Autonomie und Kontrolle geht. Außerdem kann man auch die Nützlichkeit des Begriffes „Tech-Unternehmen“ in Frage stellen. Ist Uber wirklich ein Tech-Unternehmen? Ist Tesla eins? Die großen Banken beschäftigen viele Softwareentwickler*innen – bedeutet das also, dass JP Morgan Chase auch ein Tech-Unternehmen ist?
Parallelen zwischen Wissenschaft und Tech
Weigel: Ich würde noch ergänzen, dass es eine laufende Debatte über den Prozess der Wertschöpfung auf diesen Plattformen gibt. Darüber, ob nun alle Facebook– oder Google-Nutzer*innen zugleich auch „Tech Workers“ sind, weil unsere Online-Aktivitäten den Wert dieser Plattformen steigern. Ich würde sagen, dass diese Frage wahrscheinlich mehr Resonanz in Wissenschaft und Medien findet, als innerhalb der Tech-Worker-Bewegung. Aber es gibt einige Kontakt- und Verbindungspunkte. Ich weiß zum Beispiel, dass einige Gruppen der Tech-Worker-Bewegung aufmerksam die Gewerkschaftsbildung innerhalb einiger Digitalmedien verfolgt haben. Es gibt viele interessante Parallelen zwischen wissenschaftlicher Arbeit und Tech-Arbeit insofern, als beides mal prestigevolle Beschäftigungsfelder waren, aber in vielen Fällen deprofessionalisiert und entwertet wurden.
Die Tech-Worker-Bewegung hat bislang vor allem auf „traditionelle“ Organisierungsmethoden gesetzt. Wir haben Arbeitsstreiks, Demonstrationen und Versuche der Gewerkschaftsbildung gesehen. Gleichzeitig haben sich in den vergangenen Jahren die Democratic Socialists of America (DSA) enorm vergrößert. Mehr und mehr Leute protestieren gegen den Kapitalismus an sich. Wie stark ist die Verbindung zwischen der Tech-Worker-Bewegung und der antikapitalistischen Bewegung?
Tarnoff: Ich würde gerne behaupten können, dass die Tech-Worker-Bewegung explizit antikapitalistisch ist, aber das nicht stimmt ganz. Wenn du zu einem Treffen der DSA gehst, triffst du zwar auf jede Menge Tech-Arbeiter*innen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die meisten eine antikapitalistische Haltung teilen. Kapitalismuskritische Stimmen gibt es innerhalb dieser Bewegungen hingegen gewiss. Wenn Microsoft-Angestellte beispielsweise verlangen, dass ihr Arbeitgeber*innen nicht weiter mit der US-Immigrationsbehörde ICE zusammenarbeitet, dann kritisieren sie die kapitalistische Logik der Gewinnmaximierung. Wenn Tech-Arbeiter*innen bestimmte Verträge oder Unternehmenspraktiken bekämpfen, zielen sie nicht nur auf ihre Vorgesetzten, sondern auf das gesamte System. Und diese Erkenntnis, dass nicht nur die Führungskräfte behindern, sondern die Strukturen, dass es also ums Kapital geht, diese Erkenntnis kann durchaus radikalisieren.
Frauen in Vorständen alleine reichen nicht
Weigel: Und zumindest gelegentlich passiert es, dass die Kapitalismuskritik innerhalb der Tech-Worker-Bewegung auch in Verbindung mit systematischem Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie und so weiter gesetzt wird. Zumindest manche Teilnehmer*innen haben erkannt, dass es nicht ausreicht, wenn eine Frau oder Person of Color im Vorstand sitzt. In einer Zeit, in der sich Sheryl Sandberg mit Trump trifft und Tim Cook mit Jair Bolsonaro in Davos zu Abend isst, realisieren mehr und mehr Tech-Arbeiter*innen, dass Lean In allein nicht ausreicht. Ein Beispiel: Ich habe Protest-Organisator*innen sagen hören, dass diejenigen Menschen, die unter Produkt x oder y einer Tech-Firma am ehesten leiden, allermeist so aussehen, wie diejenigen Menschen, die auch innerhalb der Tech-Firma am gefährdetsten sind. Diese Beobachtung mag nicht zwangsläufig antikapitalistisch sein. Aber die Wahrnehmung, dass bestimmte Leiden und Missstände ein Systemproblem sind, deutet auf den Wunsch hin, das System zu verändern. Und ich denke, dass immer mehr Menschen dieses System selbstbewusst „Kapitalismus“nennen.
Wenn wir über die Demokratisierung von Social Media sprechen, finden sich ja mindestens zwei wichtige Perspektiven. Viele Nutzer*innen, das ist die eine Perspektive, fordern mehr Transparenz, Mitsprache und Privatsphäre, sowie weniger Überwachung und Manipulation. Die andere Perspektive: Die Tech-Arbeiter*innen, die natürlich meist auch Nutzer*innen sind, fordern bessere Arbeitsbedingungen, frei von Belästigung und Diskriminierung, bessere Löhne und Schutzmaßnahmen, etc. Wie kann man diese beiden Perspektiven gemeinsam denken? Oder stehen die jeweiligen Interessen auch in Konkurrenz zueinander?
Tarnoff: Die Frage, wie man die Interessen von Nutzer*innen und Mitarbeiter*innen in Einklang bringt, steht im Mittelpunkt eines jeden neuen kooperativen Plattformprojekts. Wobei man noch eine dritte Gruppe hinzufügen könnte, die Mitglieder der allgemeinen Gesellschaft, denn wie wir wissen, sind nicht nur die Mitarbeiter*innen und Nutzer*innen von den Plattformen betroffen. Man denke an die Völkermorde in Myanmar, die auch über Facebook organisiert wurden.
Wenn soziale Schäden die Vorteile überwiegen
Diese Dreiteilung – Arbeiter*innen, Verbraucher*innen/Nutzer*innen und alle anderen – ist immer präsent, auch wenn digitale Plattformen die Grenzen etwas verwischen können. Eine vernünftige demokratische Abstimmung zwischen diesen verschiedenen Gruppen und innerhalb verschiedenen Fraktionen erfordert völlig neue Formen der sozialen Koordination. Es handelt sich im Grunde genommen um eine parlamentarische Frage. Wie schafft man demokratische Strukturen, in denen die unvermeidlichen Konflikte vermittelt werden und in denen Mehrheitsentscheidungen zusammenfließen können? Im Falle der Social-Media-Plattformen vermute ich, dass es tatsächlich mehr Übereinstimmung zwischen Arbeiter*innen und Nutzer*innen gibt, als angenommen wird. Die Mitarbeiter*innen großer Tech-Unternehmen befürworten oft ebenso Datenschutz, Sicherheit und Usability.
Einige Leute, wie zum Beispiel die Präsidentschaftskandidat*innen Elizabeth Warren und Bernie Sanders, wollen Unternehmen wie Amazon aufbrechen. Andere wollen Facebook „verstaatlichen“. Manche Nutzer*innen löschen aus Protest ihre Accounts, andere fordern eine Reform, was auch immer das dann bedeutet. Ben, du sagtest auf einer Veranstaltung in Berlin, dass „einige dieser Tech-Unternehmen vielleicht einfach gar nicht existieren sollten“. Könntest du das etwas näher erläutern?
Tarnoff: Nur, weil eine bestimmte Technologie existiert, bedeutet das ja nicht, dass sie weiter existieren sollte. Unter den Optionen, die uns zur Verfügung stehen – Kartellrecht, Genossenschaften, Verstaatlichungen und so weiter – befindet sich auch eine, die wir die Ludditen-Option nennen könnten. Grundsätzlich geht es darum, eine Organisation oder ein Werkzeug zu dekonstruieren, weil die sozialen Schäden die Vorteile überwiegen. Man kann beobachten, dass diese Idee in den Vereinigten Staaten momentan größere Kreise zieht, zum Beispiel beim Thema Gesichtserkennungssoftware. Es wird argumentiert, dass diese Technologie ganz besondere Gefahren bringt, insbesondere für die Klasse der Arbeiter*innen und People of Color. Ich halte diese Einschätzung für korrekt. Und ich frage mich, welche anderen Technologien in diese Kategorie fallen könnten.
Ihr seid gerade erst durch Deutschland gereist. Was ist der Eindruck von der deutschen Tech-Worker-Bewegung?
Tarnoff: Es war aufregend zu sehen, wie groß das Interesse an diesem Thema ist! Wir haben viele interessante Gespräche mit Tech-Arbeiter*innen und Informatikstudent*innen in Berlin und Leipzig geführt. Und ich durfte am ersten Meeting des Berliner Chapters der Tech Workers Coalition teilnehmen, die mit Sicherheit große Sachen machen wird. Aber ich muss zugeben, dass ich die deutsche Tech-Landschaft nicht all zu gut kenne, insofern freue ich mich darauf, mehr von meinen neuen deutschen Freund*innen zu lernen.
Interview

Ben Tarnoff arbeitet als freier Journalist in den USA und schreibt unter anderem für The Guardian und Jacobin. Er ist Mitgründer des Technologie-Magazins Logic.

Moira Weigel ist Journalistin, Buchautorin und Postdoktorandin an der Harvard Universität. Sie ist Mitbegründerin des Technologie-Magazins Logic. [Foto: Jean Ervasti]
Was wäre, wenn…
… Social Media den Nutzer*innen gehören würde?
Im 5. Teil unserer was wäre wenn-Reihe sprechen wir über Social Media Nutzer*innen. was wäre wenn ist das Online-Magazin der Initiative Offene Gesellschaft für konkrete Utopien. Unser Ziel ist es, Alternativen für die Gesellschaft sichtbar zu machen und potenzielle Lösungen ins Zentrum zu rücken.
Jedes Thema wird mit einer was wäre wenn-Frage eröffnet und anschließend in Essays, Interviews und in einem begleitenden Podcast diskutiert. Zum Wesenskern unseres Magazins gehört die Pluralität der Stimmen und Perspektiven. Die Inhalte werden deshalb, neben journalistischen Beiträgen, vor allem von Expert*innen aus Wissenschaften, Praxis und Zivilgesellschaft verfasst.
Weitere Artikel zum was wäre wenn-Thema “Social Media Nutzer*innen”:
- Was wäre, wenn Social Media den Nutzer*innen gehören würde? – von Georg Dietz
- Der Staat neben den Staaten – von tante
- Kryptokommunist*innen aller Länder, vereinigt euch! – von Erik Bordeleau
- Gestapelte Demokratie – von Michael Seemann
- „Wir im Westen können uns leisten, das Netz kritisch zu sehen“ – Interview: Valie Djordjević
- Dezentralisiert euch! – von Dennis Schubert